Jugend im Revier
Frage: Du warst 25 Jahre lang Kulturdezernent in einer Ruhrgebietsstadt. Das Ruhrgebiet wird ja weniger mit Kultur als mit Kohle und Stahl in Verbindung gebracht. Was hat dich bewogen, Kulturdezernent in Gelsenkirchen zu werden und für einen so langen Zeitraum zu bleiben?
Peter Rose: Kultur und Kunst waren mir nicht in die Wiege gelegt. Während des Krieges wurden uns Kindern im Bunker Märchen vorgelesen und Geschichten erzählt. Aber seit ich in der Schule das Lesen gelernt hatte, habe ich alles gelesen, was ich an Gedrucktem in die Finger bekam.
Das waren in der NS-Zeit vor allem Kriegsgeschichten und später Karl-May-Romane über das Leben in der arabischen Welt und Indianergeschichten aus dem amerikanischen Wilden Westen, und alles, was mir die Leiterin der Stadtbücherei an Abenteuergeschichten empfohlen hatte.
Im Konfirmandenunterricht machte uns der Pfarrer u.a. mit den Werken von Manfred Hausmann und Erich Kästner vertraut. Und mit dem Handelsschulbesuch in Bochum begann nach meiner quasi dörflichen Kindheit an der nördlichen Ruhr mit Blick auf die legendäre Henrichshütte meine Jugendzeit in einer Großstadt, in der ich auch meine Berufsausbildung zum Industriekaufmann absolvierte und ich mich dabei in der Freizeit mehr und mehr mit kulturellen Angeboten wie Theater und Konzerten vertraut machen konnte.
Aber ich spürte auch, was bei mir als Arbeiterkind in der Erziehung zu kurz gekommen war: Bildung und Kultur! Also habe ich versucht, dass autodidaktisch und an der Volkshochschule zu kompensieren, wobei gleichzeitig auch mein Interesse für die Politik geweckt wurde. Die sollte dann auch nach dem Studium über den Zweiten Bildungsweg an der Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik zu meinem Beruf werden.
Was die Karriere betrifft, so war sie für mich ein Glücksfall. Sie begann am 2. November 1964 in der legendären Bonner Baracke des SPD-Parteivorstandes als Assistent im Referat Kulturpolitik. Meine Aufgabe bestand vor allem darin, die kurz zuvor auf einem Parteitag beschlossenen „Bildungspolitischen Leitsätze“ im Rahmen der politischen Bildung organisatorisch und inhaltlich zu vermitteln und als Referent später mit den sozialdemokratischen Kultusministerien und Fraktionssprechern in den Landtagen zu koordinieren.
So entwickelte ich mich vom programmatischen „Überbau“ auf Bundesebene in Bonn über die Landespolitik im Beraterstab des Ministerpräsidenten Heinz Kühn in Düsseldorf in die konkrete Umsetzung an der kommunalpolitischen Basis, als ich in Gelsenkirchen zum Beigeordneten für Schule- und Kultur gewählt wurde. Es war ein politischer Lernprozess von der Theorie zur Praxis. Denn nach meinem demokratischen Politikverständnis ist „Kultur für alle“ immer auch „Kultur mit allen“, weil sie konkret immer nur „vor Ort“ stattfinden kann. Das habe ich versucht in der „Stadt der Industriearbeit“ umzusetzen, weil es letzten Endes immer das menschliche Tun oder die Arbeit ist, die auch Kultur schafft.
Kultur und Kunst
Frage: Was bedeutet für dich Kultur und wie siehst du das Verhältnis von Kultur und Kunst?
Peter Rose: Kultur ist für mich zunächst ganz schlicht, wie der Mensch lebt und arbeitet. Denn mit seiner eigenen Natur arbeitet er sich an der Natur ab. Er macht sich mit ihr vertraut, lernt, sie für sich zu nutzen und damit zu verändern. Er „kultiviert“ sie in einer Art „Stoffwechselprozess“, indem er seine natürlichen Fähigkeiten anwendet und weiterentwickelt. So entsteht Anderes und Neues.
Mit der Kunst ist es ähnlich. Sie entsteht, wenn der Mensch seinen Lebensraum in dessen natürlichen Funktionen, Formen, Farben und Tönen sinnlich wahrnimmt und reflektiert, um damit zu spielen und eigensinnig und eigenwillig in eine neue „ästhetische“ Form zu bringen und der „Kultur“ hinzuzufügen und der Welt öffentlich auszusetzen.
Kultur und Politik
Frage: Das Verhältnis von Kultur und Kunst ist das eine. Die andere Frage von zentraler Bedeutung für einen Kulturpolitiker ist die nach dem Verhältnis von Kultur und Politik. Was muss Politik im Blick auf Kultur leisten und was darf Politik im Blick auf Kultur nicht machen?
Peter Rose: Kultur ist in ständiger Bewegung. Der Mensch erwirbt und schafft Kultur durch lebenslangen Kontakt mit anderen Menschen. Deshalb ist Kultur auch ein Produkt der Politik, die für das Was und das Wie eines demokratischen Gemeinwesens den Rahmen vorgibt, um ein menschenwürdiges und friedliches Zusammenleben aller in Staat und Gesellschaft zu gewährleisten. Dazu gehört vor allem der freie Zugang des einzelnen Menschen zu Bildung und Wissenschaft, um verstehen zu lernen „was die Welt Im Innersten zusammenhält“, und zu erkennen, ob und „wie wir’s dann zuletzt so herrlich weit gebracht“ haben. Oder auch nicht.
In der Kultur kommt zum Ausdruck, was Politik in den Irrungen und Wirrungen zwischen Gut und Böse für das menschliche Zusammenleben in einem Gemeinwesen zustande gebracht hat. Die Politik sollte die Vielfalt der verschiedenen Kulturen respektieren, sich aber ebenso der eigenen Kultur bewusst sein und gegebenenfalls auch Grenzen ziehen, wenn unterschiedliche oder gar gegensätzliche Identitäten unüberwindbar sind.
„Die Natur ist schlau. Sie setzt durch, was sie will. Und warum? Weil sie gerissen ist“ heißt es im „Dreigroschenroman“ von Bert Brecht. Das dürfte auch für Kultur gelten. Man fragt sich allerdings, wie lange das noch gut gehen mag, wenn die Vielfalt der Natur durch die wachsende Umweltgefährdung schwindet, dafür aber die Menschheit einen unüberschaubaren „Mischmasch“ an Kultur zustande gebracht hat, weil alles Mögliche in Wortverbindungen mit Kultur „geadelt“ wird. Eckhard Henscheid hat das zum Beginn des dritten Jahrtausends in seiner Bilanz „Alle 756 Kulturen“ eindrucksvoll veranschaulicht, wie die „Kultur-Gebilde“ immer zahlreicher und beliebiger werden, und zwar von der „Ahnenkultur“ bis zur „Zweifelskultur“
Der politische Umgang mit der Umweltproblematik lässt jedenfalls erkennen, dass wir mit der Natur unseres Planeten Erde inzwischen zwar ein weltweit erkanntes Problem haben, das aber aufgrund der Vielzahl von Kulturen, politisch höchst unterschiedlich bewertetet und behandelt wird. Denn eine Weltkultur gibt es ebenso wenig wie eine Weltpolitik. Deshalb sollten wir uns auf die Vielfalt unterschiedlicher Kulturen einstellen und die politische Kulturtradition der westlichen Welt, die Demokratie in Staat und Gesellschaft, weiterhin in Europa konsequent praktizieren und beispielhaft vorleben, um den ihr zugrunde liegenden Werten und Zielen nicht zuletzt durch die Einbeziehung der Künste öffentliche Bedeutung und soziale Wirkung zu verschaffen.
Das Dreieck Kultur – Politik – Kunst
Frage: Du hast mir einmal gesagt, „Kultur ist die Substanz der Politik, Kunst ist die Substanz der Kultur“. Könntest du noch einmal etwas genauer erläutern, was genau du damit meinst.
Peter Rose: Mit dieser Formel hat Ende der 1980er Jahre der Bochumer Kulturdezernent Dr. Richard Erny auf den Zusammenhang der Komplexe Politik – Kultur – Kunst hingewiesen, um daraus ihre Bedeutung für praktische, politische, problembewusste, offene und konfliktfreudige kommunale Kulturarbeit zu begründen.
Es war die Zeit, als die vom Strukturwandel betroffenen Ruhrgebietsstädte ihre „freiwilligen“ kommunalen Ausgaben für ihre Kultureinrichtungen kritisch unter die Lupe nehmen mussten, um ihre defizitären Haushalte zu sanieren. Das Schlimmste, etwa die Schließung von Theatern und Orchestern, konnte zwar verhindert werden, aber die Abhängigkeit der Kommunen von „rettenden“ Zweckfinanzierungen durch Landeszuschüsse nach dem Prinzip „Wer zahlt schafft an!“ höhlte die Kulturautonomie der kommunalen Selbstverwaltung aus. Denn in Nordrhein-Westfalen hatten sich mit dem Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg die klassischen Einrichtungen der traditionellen Kunst- und Kulturpflege, wie Theater, Orchester und Museen in der Trägerschaft von Städten, Kreisen und Landschaftsverbänden geradezu prächtig entwickeln können.
Vor allem das Ruhrgebiet mauserte sich zu einer kulturellen „Metropolregion“, als sich in den 1960er Jahren mit APO und POP auch eine „freie Kulturszene“ als Alternative zum traditionellen Kulturverständnis vom „Guten – Schönen – Wahren“ etablierte, die, vom künstlerischen Engagement ihrer Akteure getragen, ihre Aktivitäten überwiegend selbst organisieren und finanzieren mussten und deshalb für ihre Kulturarbeit nun ebenfalls öffentliche Förderung beanspruchten. Denn diese „Kultur vor Ort“ lieferte ja nicht nur zusätzliche, sondern vor allem neue Kunst, was die Kommunen veranlasste, wenigstens dafür zu sorgen, dass sie präsentiert werden konnte, indem sie dafür geeignete Räume zur Verfügung stellten. Denn Kunst, die nicht öffentlich ist, bleibt für die Kultur des Gemeinwesens wirkungslos, weil sie nicht wahrgenommen werden kann, zumal in der Kunst immer auch ein kritischer Zeitgeist als Substanz des jeweiligen Kulturgeschehens steckt.
Ähnlich ist es mit der Politik, die, aufgrund verschiedener Regierungssysteme zwischen den Staaten, ihre Substanz auch in den unterschiedlichen Kulturen zum Ausdruck bringt, wenn die Kunst als Substanz der Kultur für staatlich repräsentative Zwecke gegängelt wird.
Ich bin davon überzeugt, dass in einer Kommune das Zusammenspiel von Kunst, Kultur und Politik zum Wohle des Gemeinwesens besser funktionieren könnte, wenn der politische Gestaltungsspielraum der Kommunen für Problemlösungen vor Ort demokratisch-flexibler wäre. Das Durchregieren von oben nach unten über Bund und Länder macht die Kommunen zu einer puren Vollstreckungsinstanz von Bund und Ländern. Von Autonomie und demokratischer Gestaltung durch Selbst- und Mitbestimmung ist dann nicht mehr viel zu spüren. Selbst den demokratisch gewählten Räten bleibt nur noch das Kopfnicken. Irgendetwas scheint also nicht mehr zu stimmen zwischen der demokratischen Kultur und der demokratischen Politik. Bleibt also nur die Kunst, weil ihr das Grundgesetz die Freiheit garantiert.
“Maloche” prägt die Kultur zwischen Ruhr und Lippe
Frage: Kommen wir wieder zurück auf das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet war zu deiner aktiven Zeit noch eine Industrieregion. Industrie, Industriearbeiter, Gewerkschaften: Welche Bedeutung hat dieser spezielle Kontext für dich als Kulturpolitiker gehabt? Worin unterscheidet sich Kulturpolitik im Ruhrgebiet von Kulturpolitik in Städten wie Frankfurt, Dresden, Stuttgart, München oder Hamburg?
Peter Rose: Das Leben im Ruhrgebiet wurde von der „Maloche“ bestimmt. Dieser Begriff aus dem Jüdischen, bezeichnete jedenfalls die Schufterei, die schwere körperliche Massenarbeit, die rund um die Uhr in Dreierschichten in Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie geleistet werden musste.
Diese Art von Arbeit wurde vor mehr als 200 Jahren in Europa mit der Entdeckung der Dampfkraft als Antrieb für Maschinen möglich. Diese Maschinen bestimmten fortan das Arbeitstempo und erhöhten die menschliche Arbeitsleistung um ein Vielfaches und beschleunigten mit der Eisenbahn auch den Alltag. Technik und Tempo machten das Revier zum Schmelztiegel für Massen von Zuwanderern aus allen Teilen Deutschlands und aus dem benachbarten Ausland.
Aber die Arbeit war nicht nur Produktionsfaktor, sondern auch ein wesentlicher Sozialisationsfaktor für das menschliche Zusammenleben in Kolonien und Wohnquartieren im Umfeld der Fördertürme von Zechen und der Schornsteine von Fabriken. In diesem Ambiente entstand die gesellschaftliche Selbstorganisation der Arbeiterbewegung in Parteien, Gewerkschaften und Kirchen sowie in Kultur- und Sportvereinen.
Diese Strukturen einer Arbeiterkultur lebten nach der Nazidiktator unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg wieder auf und waren bis in die 1970er Jahre fester Bestandteil in den Ortsteilen der Industriestädte, um sich dann im postindustriellen „Strukturwandel“ des Ruhrgebiets durch die anhaltende hohe Arbeitslosigkeit nach und nach aufzulösen. Denn – so meine Wahrnehmung – mit der industriellen Massenarbeit war in den kommunalen Gemeinwesen des Ruhrgebiets eine von Arbeit und Solidarität geprägte spezifische Kultur mit eigener Sprache und Mentalität entstanden.
Mit der traditionellen deutschen Stadtkultur der genannten Metropolen lässt sich das Ruhrgebiet, das bestenfalls eine Metropolregion ist, nicht vergleichen, weil hier die Einwohner einfach anders ticken, schon allein wegen der enormen Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur durch die Zuwanderung aus anderen Kulturen.
Hier geht es zum zweiten Teil des Interviews (erschienen am 6. Juli 2017)
Titelbild: Glückauf-Kampfbahn, Gelsenkirchen-Schalke | J. Klute CC BY-NC-SA 4.0
5850


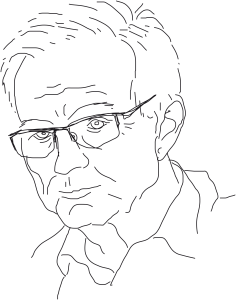




[…] „Das gibt es nur bei uns in Gelsenkirchen“ – Interview mit Peter Rose (Europablog, 01.07.2017) […]